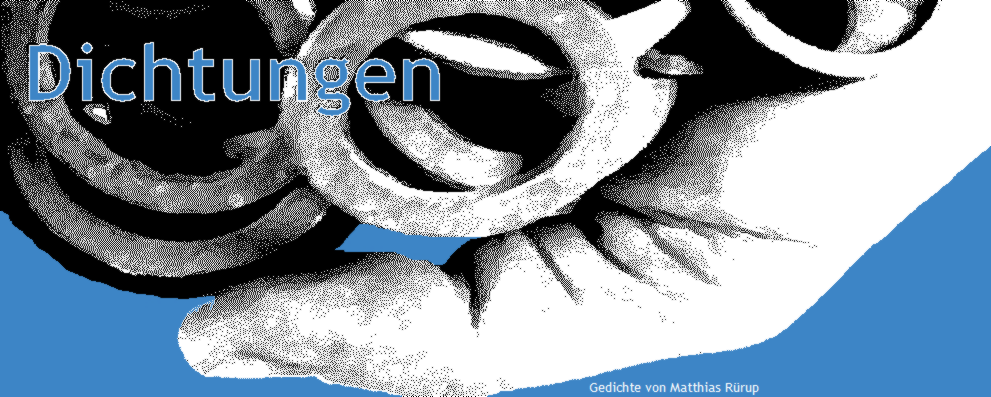(NACHTRAG: Inzwischen ist die Plattform fixpoetry als Gründen mangelnder Finanzierung offline gegangen; die dort ursprünglich im März 2014 veröffentlichte Rezension wird deshalb hier im Beitrag eingefügt)
Irgendwas aus meiner kleinen Welt.
Ex-Studierende reflektieren ihre Gegenwart
Als Florian Kessler seinen (ich sag mal: reißerischen) Essay zur Bedeutung von Arztsöhnen in der deutschen Gegenwartliteratur in der ZEIT vorab veröffentlichte, waren es nur neun weitere Beiträge, die in dem von Jan Fischer und Nicola Richter herausgegebenen e-book „Irgendwas mit Schreiben. Diplomautoren im Beruf“ bei mikrotext enthalten sein sollten. Jetzt – wo das Buch erschienen ist – sind es vierzehn Texte geworden, allesamt von ehemaligen Studierenden des „Kreativen Schreibens“ aus Hildesheim und Leipzig und alle – irgendwie – zu der Frage, wie es sich mit dem Schriftstellerdiplom in der Tasche so lebt. Da ist wohl von Mitte Januar bis mindestens März 2014 – irgendwie – bei weiteren Personen der Anreiz gewachsen, doch bei diesem Anthologie-Projekt mitzuwirken, und bei manchen Texten (vor allem dem von Stefan Mesch, indirekt auch bei Jan Kuhlbrodt), merkt man dies dann auch. Aber vielleicht täuscht das. Vielleicht stehen die Themen und Thesen, die Kessler in seinem eigenen – vorab schon so intensiv debattierten – Beitrag bearbeitet, einfach im Raum … unabhängig von seinen sprachlichen Zuspitzungen auf das Label „Speck-Lit“: Thomas Klupps satirischer Text einer allgegenwärtigen Unterwanderung und (feindlichen?) Übernahme des deutschen Literaturbetriebs durch Schreibschulabsolventen (Schreibschule immer & überall) kommt auch ohne die bildungsbürgerliche Ingroup-These Kesslers aus … und auch Stefan Mesch spricht auf sich und seine Freunde beim Journal BELLA triste bezogen davon, dass Ann Cottens Bezeichnung als „Hildesheimer Bubi-Mafia“ ganz passend sei …
Aber stopp! Es tut der jetzt erschienenen Textsammlung nicht gut, sie als weiteren Beitrag zu Florian Kesslers Polemik zu lesen. Diese ist zwar – unverändert gegenüber der Zeit-Publikation – in dem Band enthalten, aber gerade nicht als voranstehender Leittext und Bezugspunkt aller anderen, sondern als nur einer von vielen (der elfte von vierzehn) und als der, den man schon von woanders kennt. Wegen Florian Kesslers Beitrag muss man das Buch also nicht lesen oder kaufen. Wie sieht es also mit den anderen aus? Ein Überblick mit gerafften Einschätzungen:
Der erste Text im Band stammt von Jaqueline Moschkau und trägt den der Titel: „Vorwort zur literarischen Lebenskunst“. Die – auch im Ankündigungstext aufgebaute – Erwartung einer Einleitung in das Anliegen und die Struktur des Bandes wird allerdings enttäuscht. Zu lesen ist eine umständliche und unmotivierte Rezeption von Ansätzen einer Lebensphilosophie seit der Antike, deutlich in Nachfolge von Wilhelm Schmid, mäßig strukturiert durch übergroße Fragen wie „Was ist der Sinn des Lebens?“, „Was ist Glück?“, die schließlich – angeleitet durch ein Virgina-Wolff-Zitat, dass auch Dichter etwas essen müssen –bei einem Wunsch nach (Planungs-)Techniken der produktiven Verbindung von Gelderwerb und kreativen Freiräumen im Alltag landet. Zum Schluss folgt dann noch ein Sprung in kryptische Abstraktion, der einen – zusätzlich zu den grammatikalisch unklaren Sinnanschlüssen – hilflos aus dem Beitrag entlässt. Zitat: „Vielleicht ist eine Philosophie der (literarischen) Lebenskunst die Romantisierung, ja sogar Utopisierung der Theorie. Wohl eher ist es aber der Kompass, der – wenngleich mit zitternder Nadel – die etwaige Richtung in ein bejahenswertes Leben angibt.“ (S. 13 im PDF)
Danach kommt ein – wie sagt man es freundlich? – unförmig-waberndes Brainstorming von Stefan Mesch mit dem passend-selbstbezüglich-selbstreflevien Titel „Stefan Mesch ist krass drauf“. Die tragende Idee des Textes ist simpel: Hundert durchnummerierte Abschnitte (Sinneinheiten) in Form eines abwärtstickenden Countdowns aufeinander folgen zu lassen – irgendwie zum Thema „Wie ich – Stefan Mesch – leben will“ als Schriftsteller, Blogger, Rezensent usw. usf. Nach spätestens zwanzig „Sinneinheiten“ (bei Nummer 79 ungefähr: „Ich will keine Pflanzen. Ich will keinen Garten“) hat man es als Leser durchschaut und begriffen: Ok, das geht jetzt so weiter, noch weitere 24 Seiten additives Gelabber, manchmal sich sprachlich-poetisierend erhebend, manchmal auch einfach nur als Teaser und Linkverweis für das, was man anderswo von Stefan Mesch lesen kann. Neben der Link-Aufzählung von lesenswerten Beiträgen der Florian Kessler-Debatte (so scharfsinnig-sezierend wie der von
Peer Trilcke ist wirklich keiner) und dem auch in anderen Texten wiederkehrenden Hinweis, dass Krankenversicherungen für freischaffende Schriftsteller/ Kulturjournalisten irgendwie ein Thema sind, konnte ich dem Text nichts entnehmen – außer einer zunehmenden Ablehnung gegenüber dem mir hier präsentierten selbstbezüglichen Typen, der alles möglich will und macht (was er will) und dann noch meint (so im Nachsatz in eckigen Klammern nach – endlich – Eintrag 001): dieser Text wäre es wert, „geteilt zu werden“, diesem – egozentrischen Labber-Typen würde man „auf Facebook folgen“ oder „im Jahr 2016 einen Roman von ihm kaufen“ wollen (S. 43 im PDF). Werbungen um Sympathie sehen anders aus: Hier sucht einer nach nichts als Verehrern, die naiv – kleingläubig – genug sind, aufgeblähte Arroganz und Ignoranz für den Beweis von Talent und Genie zu halten …
Anschließend trägt Thomas Klupp eine – im Kontrast zu Mesch prägnante, rasante und viel zu kurze – Kolumne bei mit den Kernthesen einer a) Desillusionierung der Suhrkamp-Bestseller-Schriftsteller-Träume für die Masse der Schreibschulabsolventen (als kollektiver Abstieg in die Niederungen des Realen) und b) des gerade deswegen unaufhaltsamen Sieges des Mittelmaßes im Literaturbetrieb, da die so von den goldenen Trögen vertriebenen Nachwuchsschriftsteller – notwendig – auf sonstigen Posten beim Verlegen, Besprechen und Bepreisen von Literatur ausweichen werden (etwas anderes „als irgendwas mit Schreiben“ können sie ja nicht). Die – sicherlich von Klupp nur ironisch als leuchtend bezeichnete Zukunft ist dann die der „Schreibschule für immer & überall“. Insgesamt ist dieser Text irgendwie nett, aber in der ironischen Zuspitzung zugleich seltsam wieder ingroup-mäßig leer und nichtssagend, weil entweder unempirisch-unreflektiert falsch (als gäbe es seit Gründung der Schreibschulen keine Germanistik-Studiengänge mehr) oder zu unernst, ich- und risikolos. Wenn es nämlich wirklich eine Unterwandung bestimmter (sicherlich nicht aller) Bereiche des deutschen Literaturbetriebs durch Schreibschul-Netzwerke geben sollte, dann wäre Thomas Klupp ein wesentlicher mitverantwortlicher Akteur und nicht, wie die scheinnaive Sprecherhaltung im Text suggeriert, ein passiver Nutznießer oder opportunistischer Mittäter …
Der Beitrag von Sina Ness danach ist – bei allem Spott und aller Fabulierlust – erholsam klar und ehrlich: Endlich gibt hier jemand glaubhaft unverstellt Auskunft über die aktuelle Lage seiner Träume als Schriftsteller zu leben – oder genauer gesagt – der Beschwernisse, Einschränkungen und Perspektivverschiebungen, die es dabei bedeutet, Mutter zu sein. Allerdings, so unterhaltsam-persönlich und zugleich literarisch-verspielt dieser Beitrag auch ist, seine „Botschaft“ ist ziemlich klein und knapp: Kinder machen das Bücherschreiben nicht leichter, geben aber gerne Feedback zur sichtlichen Erzähllust der Autorin. Zitat des Schlusssatzes (ursprünglich in Klammern): „Mama, deine Geschichte hat mir so gut gefallen, dass ich fast eingeschlafen bin!“ (S. 54 im PDF)
Mirko Wenigs Text „Aus dem Alltag eines Fast-Food-Journalisten“ fällt ebenfalls in die Kategorie „Im Zweifel lieber spaßig“. Nach seinem Schreibschul-Studium hat er scheinbar einen Posten als Wirtschaftsjournalist bei einem Online-Portal gefunden und – nunja – die Art des dort verlangten Schreibens ist doch recht fern von seinen literarischen Ambitionen oder auch seiner lebensnahen Empathie (z.B. einer Aufmerksamkeit für tote, von Würmern zerfressene Igel). Durch den angeschlagenen Tonfall – einem umständlich-naiven Welterklärungston gegenüber Kleinkindern (z.B.: „Manchmal ist der kleine Mirko ganz toll traurig.“, S. 59 im PDF) – wird die inhaltliche Selbstoffenbarung allerdings sofort negiert und zurückgenommen. Denn natürlich ist der wirkliche Mikro kein „kleiner Mirko“; das ist alles nur Show, Übertreibung, Verstellung für den Zweck – nunja – einen Beitrag für eine Anthologie zum Thema „Diplomschriftsteller im Beruf“ zu verfassen. Das soll, das kann man nicht so ernst nehmen. In einem kurzen Nachtrag zum Text verweist Mikro Wenig dann noch darauf, dass er auch etwas als Erwiderung zum Beitrag von Florian Kessler zu sagen gehabt hätte, dies aber nicht hier, sondern in seinem Online-Blog getan hat …
Der folgende Text ist anonym veröffentlicht – wie den biographischen Autoreninformationen am Schluss des Bandes zu entnehmen ist – vor allem, um den letzten Arbeitsgeber nicht Anlass zu geben, das ausstehende Arbeitszeugnis anders abzufassen. Das wirkt brisant: scheinbar gab es bei der vorletzten oder vorvorletzten Anstellung der Autorin einen Chef strombergischen Kalibers … Formell ist der Beitrag, der einer Zusammenstellung von Tagebucheinträgen ähnelt, anregend kompliziert gebaut. Ständig wird zeitlich vor und zurück-springend aus einem anderen Jahr von einem anderen Job berichtet, wobei anfangs zwei parallele „Karrieren“ zu existieren scheinen: die der Journalistin und die der Barkeeperin, die sich allerdings – so suggeriert zumindest der Textverlauf – sich nach „Umwegen“ über einen engagierten Regionaljournalismus erfolgreich zu einer herausgehobenen Tätigkeit im Bereich Lobby-Journalismus für Ernährungsfragen bzw. Pressesprecherin zusammenfinden. Sogar für eine Nebentätigkeit als selbstständige Autorin scheint die neueste – ideal verantwortungsreiche, super bezahlte zukünftige Stelle – Raum als auch wertschätzendes Verständnis zu bieten. Wäre nicht der erste – ebenfalls auf das Jahr 2013 datierte Abschnitt, der von einer Bore-Out motivierten Flucht in eine Wochenend-Barkeeper-Tätigkeit irgendwo auf einen 2000er Berg spricht, man könnte diese Erzählung als ein etwas windungsreiches, letztlich aber doch gelingendes Ankommen im Beruf lesen, mit einem zunehmenden Abschied und an den Rand-Drängens der Perspektive literarischer Autor zu sein. Aber – wie gesagt – wäre dieser Textanfang nicht, in dem neben dem Wunsch endlich die Diplomarbeit fertig zu bekommen (!) auch von einem eigentlichen Leben als Schriftstellerin die Rede ist, man würde der Erfolgsgeschichte fast verfallen. Was für eine wunderbar-doppelbödige und ehrliche Erzählung, die auch selbstkritische Offenbarungen von arrogant-karrieristischen Überlegenheitsgefühlen gegenüber Minderarbeitern mit geringerem Engagement und journalistischem Anspruch nicht ausspart!
Kontrastiert wird dieser – irgendwie tiefergehende – Text durch den nachfolgenden – ich sag mal – lustig-absurd-wirkungsorientierten Poetry-Slam-Beitrag von Lino Wirag mit dem Titel „Rosette, Karlheinze und Adonius hotten zu DJ Retarded Tetris“, der mit dem eigentlich alles sagenden Klammertext abbricht: „[endet hier wegen Unsinns]“ (S. 90 im PDF)
Wiederum ernsthafter, an einer ehrlich-literarischen Aufarbeitung einer Lebensgeschichte (womöglich der eigenen) interessiert, zeigt sich der anschließende Text von Alexandra Müller, der, jeweils unterbrochen bzw. kommentiert von „Fiktiven Gesprächen am Gartenzaun“ zwischen der Mutter und einer Nachbarin, vom Berufseintritt einer Schreibschulabsolventin berichtet, die sich immer wieder hadernd und neu entdeckend schließlich für etwas „richtiges“ – ein Radio-Volontariat – entschieden hat; eine Jobbeschreibung, die die Mutter endlich auch über den Gartenzaun hinweg freudig-offensiv kommunizieren kann.
Der folgende Text von Johannes Schneider (Das Lesen der anderen. Fünf Lektionen) ist vergleichsweise analytisch angelegt: Das Schriftstellerstudium wird als Gelegenheit nicht nur der Übung, sondern auch der Selbstvergewisserung, des Verlusts von Illusionen und schöntuenden Manierismen beschrieben. Positiv hervorgehoben wirddie eigene Ziel- und Rollenfindung als nicht-schriftstellernder Journalist, der als Ex-Schreibschulstudent besonders um die Notwendigkeit und Möglichkeit einer Verbesserung von Texten weiß.
Auch Jan Fischer, der Herausgeber des Bandes, trägt eine Lebensgeschichte bei – die seines Studienabbruchs, weil es ja auch ohne Abschluss mit dem bezahlten Multifunktionsschreiben gut zu laufen schien und alles in allem immer noch läuft – mit Nacht-Job im 4-Sterne-Hotel als Barkeeper und gelegentlichen Speisezettelbeschränkungen auf Nudeln: der (!) Roman ist fertig, renommierte Zeitschriften drucken weiter seine Beiträge und als mit weiteren Aktivitäten Luftgitarrist und Rampensau scheint er auch zeitlich gut ausgelastet. Kurz: Hier lebt scheinbar einer den Traum der künstlerischen Selbstständigkeit – keineswegs immer überglücklich und sorgenfrei, aber mehr darf man wohl kaum erwarten bei real gelebten Träumen. Jan Fischer scheint das zu ahnen.
Dann folgt der Beitrag von Florian Kessler, über den hier nichts mehr gesagt sein soll: Man kennt ihn ja schon aus der Zeit.
Martin Spieß (Wohlan, wenn es euer Begehr ist) kann von einem noch erfolgreicheren, weil finanziell weitaus gesicherteren und leichteren Eintritt in eine Künstlerexistenz berichten: Die biografische Nische einer Nerd-Existenz als Rollenspieler habe ihn quasi anstrengungslos-explosionsartig zu lukrativen Auftrittsmöglichkeiten als Bänkelsänger auf Mittelaltermärkten und schließlich zu einer Liedermacher-Karriere geführt, die er und sein Mitstreiter im Duo nun in Richtung auch aktuell-politischer Songs fortführen werden. Der als Teaser abgedruckte Liedtext vom kleinen Nazi kann – nun ja – höhere lyrisch-formale Ansprüche, was Rhythmus und Reime angeht, nicht wirklich befriedigen. Aber auch als Beitrag zum Antifaschismus verbleibt der Text auf der Ebene von Stereotypen und Ressentiments, die allein deswegen beklatscht und belacht werden dürften, weil der Feind, der Unhold – der Nazi – sowieso verachtenswert, böse und dumm ist. Natürlich darf es in einem freiheitlichen Kulturbetrieb auch das geben, und sicher ist es nett, wenn es sich davon leben lässt, aber …
Jan Kuhlbrodt kommt nun nicht aus Hildesheim, sondern vom Leipziger Literaturinstitut und auch ansonsten, das betont er, aus dem Osten. Das führe zu einer grundsätzlich anderen, gebrocheneren Perspektive auf intellektuelle Milieus, deren anstrebenswert sozial höhere Stellung mit einer DDR-Biographie als weniger selbstverständlich erscheint. „Schriftsteller sein“, so summiert er am Ende seiner Laufbahnerzählung schließlich (S. 134 im PDF), „sei ein Privileg.“, also – ich interpretiere – etwas Unverdientes, ein Geschenk der Gesellschaft, die eine solche Existenz zulässt, toleriert oder sogar wertschätzt, aber eben nicht auch noch dafür sorgt, das Schriftsteller ein gutes Auskommen und keine Sorgen haben. Sich für ein Leben als Schriftsteller zu entscheiden, dies bedeute – ich übertreibe, die mir als Ebenfalls-Ossi sehr entsprechende Analyse Kuhlbrodts – eine Freiheit des (Sozial-) Schmarotzertums: Irgendwie, irgendwann, irgendwelche Texte zu verfassen, die dann andere Leute – Leute mit Anstellung und Verantwortung – als Bücher drucken und verbreiten. Statt einer sorgenvollen Beschwerde über eine prekär-unsichere Einkommensperspektive für Schriftsteller plädiert Kuhlbrodt so – ossihaft-radikalprotestantisch – für mehr Genügsamkeit und Demut der sogenannten Geisteseliten und für mehr Achtung für die Menschen, die Werktätigen, die mit ihrer Hände Arbeit etwas Nützliches tun.
Der letzte Beitrag des Bandes stammt von Tilman Strasser und hat die Form eines Gesprächsprotokolls beim Vorsprechen zum Schriftstellerstudium. Wiedergegeben sind lediglich die monologisierend-belehrenden Parts des Vorsitzenden der Auswahlkommission, der auf der Sachebene dem namenslosen Kandidaten die Schwierigkeiten einer Schriftstellerlaufbahn erläutern möchte, sich dabei mit ihm auf der Ebene der Du-Botschaft bzw. des Appells verheddernd – dass diese Hinweise keineswegs (oder doch) als Bedenken hinsichtlich der Eignung und des Talents des Kandidaten und Abraten gemeint seien … Das liest sich flüssig und unterhaltsam und enthält kommunikationspsychologisch interpretiert, die schöne Pointe, dass es angehenden Schriftstellern wohl unausweichlich schwer fällt, die Informationen über einen schwierigen Berufseinstieg wahr und ernst zu nehmen, weil dies mit ihrem selbstbezogenen Hoffen und Fragen konfligiert als Schriftsteller eine Entdeckung, eine Ausnahmeerscheinung zu sein …
Insgesamt gesehen ist der vorliegende Band ein bunter Strauß von Texten, die wohl alle – irgendwie – zum selben Thema geschrieben wurden, aber in ihrer Form von Lebensbericht, Farce bis Essay und von ihrem literarischen, journalistischen und inhaltlichen Anspruch derart divergieren, dass man sich an der Farbenvielfalt kaum freuen kann. Für jemand der humoristische Entspannung sucht, werden die ernst-ehrlichen Reflektionen und analytischen Beiträge stören. Und umgekehrt sind für mich, der ich etwas substanziell-systematisch Gehaltvolles zum titelgebenden Thema des Bandes (Diplomautoren im Beruf) erwartet hatte, die vielen belanglosen und insbesondere die oberflächlich-selbstdarstellerischen Beiträge schlicht ein Tort, instrumentell gesprochen: Unfreiwillig versäumte Lebenszeit.
Insofern könnte man positiv summieren: In diesem Band ist für jeden etwas dabei, der mal kurzweilig und/oder analytisch angetippt etwas als und über das Leben von Schreibschulabsolventen erfahren möchte. Wer allerdings fortführend-vertiefende Beiträge zur Kessler-Debatte sucht, wird ebenso enttäuscht, wie derjenige der an das Buch mit einem berufssoziologischen Erkenntnisinteresse herantrat. Letzteres ist umso enttäuschender als es vor allem die Eingegrenztheit der Perspektive der hier versammelten Diplomautoren (drei davon sogar noch ohne Diplom) dokumentiert. Solche ungeordnete Übergänge in Anstellungsverhältnisse nach dem Studium, wie sie hier berichtet werden, oder solcherart ungesichert-prekären Selbstständigkeits-Existenzen sind aus einer berufssoziologischen Perspektive keineswegs untypisch für geistes- und sozialwissenschaftliche Studiengänge (ohne die klassischen Professionen Jurist, Mediziner, Theologe und – eingeschränkt – Lehrer), die eben auf unklar-diffuse Berufsfelder vorbereiten. Da kenne ich zu meinem eigenen Ex-Studiengang, dem Diplompädagogen, selbst ausreichend vielfältige Publikationen, die die Normalität längerer Übergangs- und praxisbezogener Nachqualifizierungsphasen nach dem Studienabschluss dokumentieren – dabei aber systematisch darstellend, dass spätestens nach fünf Jahren die Berufseinmündung in einen gut bezahlten Dauerjob funktioniert habe (trotz aller persönlichen Sorgen und Krisen der Absolventen zwischendurch). Dies scheint nun, so lese ich die im vorliegenden Buch versammelten Texte, für Diplomschriftsteller – die doch alles in allem eher Kulturjournalisten zu sein scheinen – ganz ähnlich zu gelten. Nur sagen müsste es man ihnen mal, so dass sie solche selbstbezogenen Such- und Vergewisserungsbücher wie dieses nicht mehr vorlegen müssten.
Ärgerlich stimmt mich an dem Buch schließlich das Fehlen eines Vorworts oder einer Handreichung für die Leserinnen und Leser, die mir geholfen hätten, das eigentliche – untheoretisch-unambitionierte – Anliegen (Wir schreiben einfach mal über uns) und die Struktur des Bandes zu erschließen. Mir erscheint er letztlich wie eine willkürliche Sammlung verfügbarer Beiträge, geordnet allein durch das Anliegen für ein abwechslungsvolles Programm zu sorgen, so dass immer ein ernster auf einen lustigen und ein literarischer auf einen essayistischen Text folgen muss …
Schließlich noch eines zum Schluss – ein autobiographischer Nachtrag: Für mich was dieses Buch mein erstes e-book. Nur als solches ist es im Verlag mikrotext erhältlich. Insofern habe ich es auch dazu genutzt, für mich diese Lektüre- und Publikationsform zu erproben. Hier mein Erfahrungsbericht: Dass ich mir zum Lesen einen E-Book-Reader auf mein Smartphone installiert musste, erwies sich als kosten- und problemlos – selbst bei meinen nicht mehr allzu aktuellen und damit nicht allzu leistungsfähigen Modell. Ungünstig war es aber, das Buch auf dem Smartphone als PDF betrachten zu wollen. Die ständige Notwendigkeit zu Zoomen und zu Schieben war viel zu umständlich und nervig. Praktikabler war, das Buch im EPub-Format zu lesen. Dieses Dokument-Format erlaubt es dem Reader, die Zeilen- und Seitenumbrüche des Textes an das – in meinem Fall recht kleine Display – des Smartphones anzupassen, so dass ein Lesen bei angenehmer Schriftgröße möglich war. Das besonders Tolle bei diesem Leseerlebnis war für mich – es hat nichts mit dem Buch, sondern eher mit dem Format zu tun –, dass ich, regelmäßig viel früher wach als meine Partnerin, endlich sorglos schon im morgendlichen Halbdunkel geruhsam im Bett lesen konnte ohne eine Lampe anzumachen oder durch Seitengeblätter hässliche Störgeräusche zu erzeugen. Dass erleuchtete Display des Smartphones vor Augen, locker fingerstreichend die nächsten Textteile herbeirufend, hatte ich sehr angenehme Morgenstunden. Hätte das hier besprochene Test-E-Büchlein meinen Erwartungen entsprochen, ich wäre vollends beglückt gewesen.
Jan Fischer & Nikola Richter (Hrsg.). Irgendwas mit Schreiben: Diplomautoren im Beruf. mikrotext: Berlin 2014.