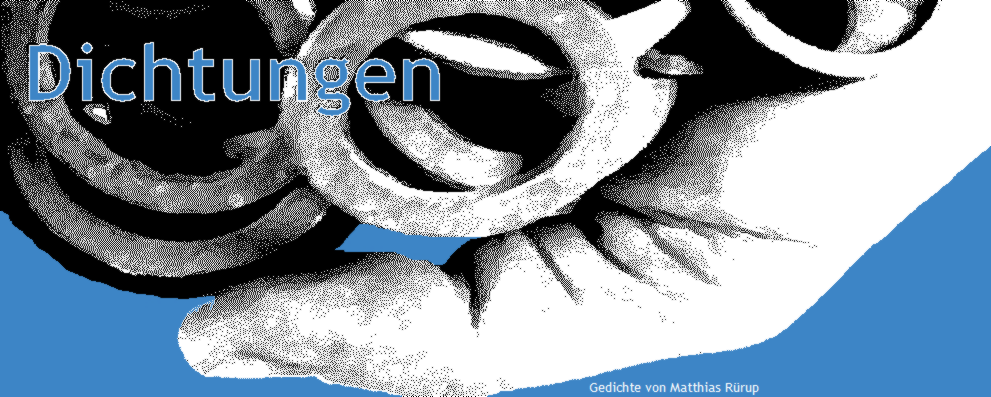Unter dem Titel "Majakowski zur Unzeit" bespreche ich auf dem Webportal www.fixpoetry.com den im Herbst 2014 erschienenen Gedichtband "Der fliegende Proletarier" von Wladimir Majakowski.
Hier der Link zur Rezension: .../kritiken/wladimir-majakowski/der-fliegende-proletarier (NACHTRAG: Inzwischen ist die Plattform fixpoetry als Gründen mangelnder Finanzierung offline gegangen; die dort ursprünglich veröffentlichte Rezension wird deshalb hier im Beitrag eingefügt)
=================
Ich übertreibe: Selbstverständlich ist der Dichter Wladimir Majakowski schon so sehr Teil europäischer Kulturgeschichte, dass sich das editorische Anliegen ein bisher unbekanntes Poem der deutschen Literaturpublikum zugänglich zu machen, eigentlich von selbst rechtfertigen dürfte. Zum steht diese Veröffentlichung nicht allein. Als Band 3 in der neuen Buchreihe „ReVers“ des J. Frank-Verlages neben ebenfalls bisher verborgenen Poemen von Konstantios Kavakis (1865-1833) und Wilfried Owen (1893 – 1918) bietet sich kaum Anlass für eine Deutung als irgendwie politische Positionsnahme im aktuellen Konflikt. Allerdings schützen ursprünglich apolitische Intentionen nicht vor zeitgenössischen Kontexten, Ausdeutungen und Vereinahmungsversuchen. Erschienen ist der Band schließlich im Herbst 2014 inmitten einer zunehmend vereisenden politischen Großwetterlage mit Russland als zentralem Antagonisten. Dahinein ein Gedicht Majakowskis zu publizieren, einem im Russland wohl immer noch verehrten Lyriker der revolutionär-euphorischen Anfänge der Sowjetunion, das könnte man gut und gerne mit dem schönen Wort „Chuzpe“ versehen. Irgendwie mutig, irgendwie irritierend: gegen den Zeitgeist; wie ein Hinweis darauf, die russische Literatur als Teil der europäischen Geisteswelt und als innigen Anregungs- und Bezugsraum gerade der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts nicht zu vergessen. Und kaum einer wäre wohl geeigneter gewesen als Majakowski ein solches – notwendig ambivalent-schillerndes – Signal zu senden: Majakowski, der kommunistische Agitator; Majakowski, der saalfüllende, vielgelesene Volkspoet, Majakowski, der lyrische Revolutionär, Form- und Sprachveränderer.
Einerseits, so wird am Bespiel Majakowski augenscheinlich, haben wir da eine irgendwie bedenkliche gemeinsame Tradition voll Radikalität und Ideologisierung, die man wohl gerne als überwunden und gestrig abtun würde, anderseits aber eine fortwirkende Tradition von Sprechweisen, Abgrenzungen und Verweisungen, ohne die sich die europäische Lyrik der Gegenwart kaum verstehen lässt – in ihrem Pendeln zwischen einer hermetischen Abschließung ins liebhabermäßig Gehobene und ihrer poetry-slam-förmigen Hinwendung zur Menge: Zwischen Widerwillen am und Willen zum Verstanden-Werden und Wirken-Wollen; zwischen Lyrik als elitär-geheimzirkelhaftes oder sich-verschwisternd-öffentliches Sprechen, zwischen Poetisierung als angesprochene Zielgruppe oder gesellschaftliches Reformprogramm. Und Majakowski, pauschal betrachtet, steht für jeweils die zweite, der hier sicherlich allzu stereotyp/idealtypisch einander entgegengesetzten Alternativen.
Wenn man allerdings Differenziertes über den Lyriker Majakowskis erfahren möchte, so ist dafür das im J. Frank-Verlag vorgelegte Poem „Der fliegende Proletarier“ ein denkbar ungünstiges Studienobjekt. Es ist, bei aller Sprachgewalt und -freude, die es vermittelt, wenig mehr als eine Werbeschrift zur Spendensammlung für den sowjetischen Flugzeugbau, vorgeführt a) anhand einer Zukunftserzählung über die letzte Luftschlacht mit dem amerikanischen Kapitalismus (der Moskau mit Drohnen einzuäschern sucht und erst durch eine auf regime change zielende Agitation – hier: der amerikanischen Volksmassen gegen ihre bourgeoisen Unterdrücker – besiegt werden kann) und b) anhand eine rosafarbene Schilderung des friedvoll-glückseligen Privatlebens der allzeit-umher-fliegenden Menschen danach im voll entfalteten, siegreichen Kommunismus.
Dabei kann man sich durchaus an dem hymnisch-wechselnden, pathetisch bis kecken Ton Majakowskis – von Preckwitz sichtlich engagiert und freundvoll übertragen – delektieren; auch die typisch zeilenweise eingerückte Schreibweise, der in je drei bis vier Subeinheiten gebrochenen Langverse Majakowskis lässt sich als mitreisende Rhythmisierung erkennen und genießen. Inhaltlich jedoch begegnet man vor allem dem Agitator Majakowski und vielleicht noch den typischen zeitgenössischen Phantasien einer idealen kommunistische Zukunft voller Technikbegeisterung und einer irgendwie arbeitsam-triebbereinigt-harmonisierten (weder zu sexuellen noch alkoholischen Ausschweifungen neigenden) Menschheit wie man sie auch in den utopischen Romanen der frühen Sowjetzeit findet.
Insofern legt der Verlag mit dem diesem Büchlein mehr ein zeitgeschichtliches Dokument aus dem Jahr 1925 vor, dessen Bedeutung zum Verständnis der fortwirkenden Bedeutung der Poetologie Majakowskis eher gering ist – aber als Einladung für ein intensiveres und breiteres Nachlesen, was es mit dem ehemals so berühmten Lyriker Majakowski so auf sich hat, durchaus wertgeschätzt werden kann. Dazu leistet mit Bestimmtheit auch die bewährt liebevolle Gestaltung des Buches durch den Verlag ihren Beitrag. Insbesondere die futuristisch angelehnten Illustrationen Jakob Hinrichs, schwarz-weiß mit einem deutlichen Goldton, sind als Bereicherung und Schmankerl hervorzuheben.
Hilfreich für eine vertiefte und weitere Auseinandersetzung sind sicherlich auch die dem Langgedicht beigegebenen Anmerkungen und die editorische Notiz des Übersetzers Boris Preckwitz, eine tabellarische Darstellung des Lebens und künstlerischen Schaffens Wladimirs Majakowskis im Kontext gesellschaftlicher und politischer Ereignisse sowie ein Nachwort von Jan Kuhlbrodt, das „Majakowski als Prophet“ thematisiert.
Wenngleich – hier sei ein kleine kritische Anmerkung erlaubt – Kuhlbrodts Nachwort eher als eine privatime Assoziationskette der eigenen Begegnungen mit dem künstlerischen Topos des Fliegens und der irgendwie verstreut und gegenläufig-gegensätzlichen eigenen Berührungen mit Majakowski erscheint, die letztlich zwar auf eine Verbrüderung / Vereinnahmung im eigenen Willen zum Langedicht und zum Prophetismus / Futurismus hinauslaufen, aber wenig mit Majakowski selbst als Person, Poet, Kind seiner Zeit und Kultfigur im realen Sozialismus zu tun hat. Majakowskis mündig-selbstbewusste fliegende Proletarier verwandeln sich bei Kuhlbrodt letztlich sogar zum Zerrbild ausgelassener Urlaubsreisender auf dem Weg nach Mallorca (das ewig-tumbe Untertanenvolk der bürgerlichen Eliten), deren Gegenwart er – in einer nicht anders als zynisch zu nennenden Umkehrung ihres Ursprungssinns – mit den berühmten Majakowski-Versen einer Aufhebung der Geschichte zum Besseren („Wolln die Schindmähre zu Schanden reiten“) als genusssüchtiges Marschieren in den Weltuntergang kommentiert: „Links / Links / Links“.
Womöglich missdeute ich hier aber auch Kuhlbrodts Schlusszitat. Zustimmen mag ich ihm schließlich in der These, dass man bei Majakowski die poetisch und gesellschaftlich inspirierende Kraft einer Zukunft als Verheißung sehen und lernen kann, als sich in der Gegenwart spiegelndes Versprechen, als Ansporn und Anregung zum Guten, zum Frieden, zur Verständigung, zum Leben und Leben lassen – bei Majakowski (früher einmal) hieß das eben „Kommunismus“.
Wladimir Majakowski (1925/2014): Der fliegende Proletarier. Übersetzt von Boris Preckwitz, Illustrationen von Jakob Hinrichs, Nachwort von Jan Kuhlbrodt. Edition ReVers #03. Berlin: Verlagshaus J. Frank, 124 Seiten, ISBN: 978-3-940249-62-3, Preis: 14,90 €
Majakowski zur Unzeit!? Boris Preckwitz übersetzt sowjetische Propaganda
Die Frage stellt sich schon: Was soll uns Majakowski, der russische Revolutionslyriker (1893 bis 1930), gerade heute – angesichts einer sich scheinbar unaufhaltsam verschärfenden Konfrontation des Westen mit Russland; eines Russlands, dass von seiner politischen Ausrichtung kaum etwas mit der früheren Sowjetunion gemein hat, aber wohl Biographien und Kultur? Warum legt ein deutscher Verlag gerade jetzt ein bisher in Deutschland noch nicht erschienenes Langgedicht Wladimir Majakowskis vor, noch dazu ein eindeutig kommunistisches Werk? Was will uns der Verlag, was will uns der Übersetzer Boris Preckwitz damit sagen? Was sollen wir verstehen? Russlands Herkunft und Gegenwart aus Propaganda und Agitation?Ich übertreibe: Selbstverständlich ist der Dichter Wladimir Majakowski schon so sehr Teil europäischer Kulturgeschichte, dass sich das editorische Anliegen ein bisher unbekanntes Poem der deutschen Literaturpublikum zugänglich zu machen, eigentlich von selbst rechtfertigen dürfte. Zum steht diese Veröffentlichung nicht allein. Als Band 3 in der neuen Buchreihe „ReVers“ des J. Frank-Verlages neben ebenfalls bisher verborgenen Poemen von Konstantios Kavakis (1865-1833) und Wilfried Owen (1893 – 1918) bietet sich kaum Anlass für eine Deutung als irgendwie politische Positionsnahme im aktuellen Konflikt. Allerdings schützen ursprünglich apolitische Intentionen nicht vor zeitgenössischen Kontexten, Ausdeutungen und Vereinahmungsversuchen. Erschienen ist der Band schließlich im Herbst 2014 inmitten einer zunehmend vereisenden politischen Großwetterlage mit Russland als zentralem Antagonisten. Dahinein ein Gedicht Majakowskis zu publizieren, einem im Russland wohl immer noch verehrten Lyriker der revolutionär-euphorischen Anfänge der Sowjetunion, das könnte man gut und gerne mit dem schönen Wort „Chuzpe“ versehen. Irgendwie mutig, irgendwie irritierend: gegen den Zeitgeist; wie ein Hinweis darauf, die russische Literatur als Teil der europäischen Geisteswelt und als innigen Anregungs- und Bezugsraum gerade der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts nicht zu vergessen. Und kaum einer wäre wohl geeigneter gewesen als Majakowski ein solches – notwendig ambivalent-schillerndes – Signal zu senden: Majakowski, der kommunistische Agitator; Majakowski, der saalfüllende, vielgelesene Volkspoet, Majakowski, der lyrische Revolutionär, Form- und Sprachveränderer.
Einerseits, so wird am Bespiel Majakowski augenscheinlich, haben wir da eine irgendwie bedenkliche gemeinsame Tradition voll Radikalität und Ideologisierung, die man wohl gerne als überwunden und gestrig abtun würde, anderseits aber eine fortwirkende Tradition von Sprechweisen, Abgrenzungen und Verweisungen, ohne die sich die europäische Lyrik der Gegenwart kaum verstehen lässt – in ihrem Pendeln zwischen einer hermetischen Abschließung ins liebhabermäßig Gehobene und ihrer poetry-slam-förmigen Hinwendung zur Menge: Zwischen Widerwillen am und Willen zum Verstanden-Werden und Wirken-Wollen; zwischen Lyrik als elitär-geheimzirkelhaftes oder sich-verschwisternd-öffentliches Sprechen, zwischen Poetisierung als angesprochene Zielgruppe oder gesellschaftliches Reformprogramm. Und Majakowski, pauschal betrachtet, steht für jeweils die zweite, der hier sicherlich allzu stereotyp/idealtypisch einander entgegengesetzten Alternativen.
Wenn man allerdings Differenziertes über den Lyriker Majakowskis erfahren möchte, so ist dafür das im J. Frank-Verlag vorgelegte Poem „Der fliegende Proletarier“ ein denkbar ungünstiges Studienobjekt. Es ist, bei aller Sprachgewalt und -freude, die es vermittelt, wenig mehr als eine Werbeschrift zur Spendensammlung für den sowjetischen Flugzeugbau, vorgeführt a) anhand einer Zukunftserzählung über die letzte Luftschlacht mit dem amerikanischen Kapitalismus (der Moskau mit Drohnen einzuäschern sucht und erst durch eine auf regime change zielende Agitation – hier: der amerikanischen Volksmassen gegen ihre bourgeoisen Unterdrücker – besiegt werden kann) und b) anhand eine rosafarbene Schilderung des friedvoll-glückseligen Privatlebens der allzeit-umher-fliegenden Menschen danach im voll entfalteten, siegreichen Kommunismus.
Dabei kann man sich durchaus an dem hymnisch-wechselnden, pathetisch bis kecken Ton Majakowskis – von Preckwitz sichtlich engagiert und freundvoll übertragen – delektieren; auch die typisch zeilenweise eingerückte Schreibweise, der in je drei bis vier Subeinheiten gebrochenen Langverse Majakowskis lässt sich als mitreisende Rhythmisierung erkennen und genießen. Inhaltlich jedoch begegnet man vor allem dem Agitator Majakowski und vielleicht noch den typischen zeitgenössischen Phantasien einer idealen kommunistische Zukunft voller Technikbegeisterung und einer irgendwie arbeitsam-triebbereinigt-harmonisierten (weder zu sexuellen noch alkoholischen Ausschweifungen neigenden) Menschheit wie man sie auch in den utopischen Romanen der frühen Sowjetzeit findet.
Insofern legt der Verlag mit dem diesem Büchlein mehr ein zeitgeschichtliches Dokument aus dem Jahr 1925 vor, dessen Bedeutung zum Verständnis der fortwirkenden Bedeutung der Poetologie Majakowskis eher gering ist – aber als Einladung für ein intensiveres und breiteres Nachlesen, was es mit dem ehemals so berühmten Lyriker Majakowski so auf sich hat, durchaus wertgeschätzt werden kann. Dazu leistet mit Bestimmtheit auch die bewährt liebevolle Gestaltung des Buches durch den Verlag ihren Beitrag. Insbesondere die futuristisch angelehnten Illustrationen Jakob Hinrichs, schwarz-weiß mit einem deutlichen Goldton, sind als Bereicherung und Schmankerl hervorzuheben.
Hilfreich für eine vertiefte und weitere Auseinandersetzung sind sicherlich auch die dem Langgedicht beigegebenen Anmerkungen und die editorische Notiz des Übersetzers Boris Preckwitz, eine tabellarische Darstellung des Lebens und künstlerischen Schaffens Wladimirs Majakowskis im Kontext gesellschaftlicher und politischer Ereignisse sowie ein Nachwort von Jan Kuhlbrodt, das „Majakowski als Prophet“ thematisiert.
Wenngleich – hier sei ein kleine kritische Anmerkung erlaubt – Kuhlbrodts Nachwort eher als eine privatime Assoziationskette der eigenen Begegnungen mit dem künstlerischen Topos des Fliegens und der irgendwie verstreut und gegenläufig-gegensätzlichen eigenen Berührungen mit Majakowski erscheint, die letztlich zwar auf eine Verbrüderung / Vereinnahmung im eigenen Willen zum Langedicht und zum Prophetismus / Futurismus hinauslaufen, aber wenig mit Majakowski selbst als Person, Poet, Kind seiner Zeit und Kultfigur im realen Sozialismus zu tun hat. Majakowskis mündig-selbstbewusste fliegende Proletarier verwandeln sich bei Kuhlbrodt letztlich sogar zum Zerrbild ausgelassener Urlaubsreisender auf dem Weg nach Mallorca (das ewig-tumbe Untertanenvolk der bürgerlichen Eliten), deren Gegenwart er – in einer nicht anders als zynisch zu nennenden Umkehrung ihres Ursprungssinns – mit den berühmten Majakowski-Versen einer Aufhebung der Geschichte zum Besseren („Wolln die Schindmähre zu Schanden reiten“) als genusssüchtiges Marschieren in den Weltuntergang kommentiert: „Links / Links / Links“.
Womöglich missdeute ich hier aber auch Kuhlbrodts Schlusszitat. Zustimmen mag ich ihm schließlich in der These, dass man bei Majakowski die poetisch und gesellschaftlich inspirierende Kraft einer Zukunft als Verheißung sehen und lernen kann, als sich in der Gegenwart spiegelndes Versprechen, als Ansporn und Anregung zum Guten, zum Frieden, zur Verständigung, zum Leben und Leben lassen – bei Majakowski (früher einmal) hieß das eben „Kommunismus“.
Wladimir Majakowski (1925/2014): Der fliegende Proletarier. Übersetzt von Boris Preckwitz, Illustrationen von Jakob Hinrichs, Nachwort von Jan Kuhlbrodt. Edition ReVers #03. Berlin: Verlagshaus J. Frank, 124 Seiten, ISBN: 978-3-940249-62-3, Preis: 14,90 €